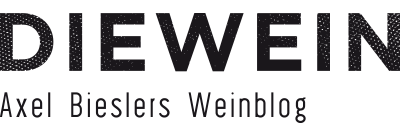© Foto Andreas Durst
VIVE LA VIELFALT
Geht die Güte der Weine auf Kosten der Vielfalt? Eine Spurensuche
Neben Art der Vergärung, Mazeration oder Hefelager hat es kürzlich auch die Wahl der Klone unter die Top 10 der klügsten Fragen aller Weinbesserwisser geschafft. Schlau formuliert und auf der Höhe der Zeit, beinhaltet diese dann bereits die kompetenteste aller möglichen Antworten. Wer heute beim Spätburgunder aka Pinot Noir ganz vorne mit dabei sein will, hat mindestens fünf dreistellige Zahlenkolonnen parat, um den Winzer als Sparringspartner ein für alle Mal in seine Schranken zu weisen: 115, 113, 112, 777 oder 667 sind keine Notrufnummern, sondern die Bezeichnungen für kleinbeerige Pinot-Klone aus Frankreich, für die, so wollen es die Hobbyexperten besser-wissen, quasi Pflanzpflicht besteht, wenn der Winzer denn vorne mitmischen will im Konzert der großen Pinots dieser Welt. Tatsächlich wächst die Zahl vorzüglicher deutscher Spätburgunder stetig an, zuweilen ziehen sie gar an ihren Nachbarn aus Frankreich vorbei. Dass es sich bei solchen Weinen allerdings rundweg um Reben aus den redundant zitierten französischen Klonen handelt, glauben vermutlich nur die externen Berater, die eigentlich niemand um ihren Service gebeten hat. Es wäre überdies ein echter Verlust, würde Spätburgunder in Deutschland nur noch französisch fortgepflanzt werden.

© Foto Andreas Durst
Würden wir eine Grünlese machen, wäre der Behang viel zu schwer und der Wein zu leicht.Philipp Bossert
Viele der gängigen deutschen Klone stammen aus der Marienfelder-Familie, deren Abkömmlinge zu einer Zeit vermehrt wurden, als der hiesige Spätburgunder selten reif aber fast immer faul wurde. Die Lockerbeerigkeit der Marienfelder hielt dagegen und erwies sich als wesentlich robuster gegen Botrytis. Wenn ihre Weine heute einen schlechten Ruf besitzen, sind nicht sie, sondern die damaligen Zeiten dafür verantwortlich. Kühle Jahre, zu hohe Erträge oder Maischeerwärmung prägten den marmeladigen Geschmack deutscher Spätburgunder bis in die neunziger Jahre. Als delikater Beweis darf der 2014 Gundersheimer Spätburgunder der Geschwister Johanna und Philipp Bossert aus Rheinhessen gelten. Wer bei diesem feinen Wein den Klon zu schmecken glaubt, besitzt keine blühende Phantasie, sondern hangelt sich durch ein schnödes Leben ohne Genuss, weil der ja immer schon vorgeschrieben ist. Freilich, es sind Marienfelder, aus denen bei den Bosserts straffe Pinots mit kühler Frucht entstehen. Mit rund fünf Jahren befinden sich die Reben gerade in ihrer Sturm und Drang-Phase, der begegnen die Bosserts nicht mit radikalen Ausdünnmaßnahmen, sondern mit Geduld und behutsamen Eingriffen. »Natürlich müssen wir den Ertrag etwas zügeln, aber wir greifen erst ein, wenn die Trauben in die Reifephase übergehen«, sagt Philipp Bossert, »würden wir eine Grünlese machen, wäre der Behang am Ende viel zu schwer und der Wein zu leicht.« Ein paar mehr Trauben an einem Stock müssen also nicht per se geringere Qualitäten bedeuten. Es geht jetzt aber auch nicht darum, umgekehrt die burgundischen Klone zu verteufeln, um ein Hoch auf die guten alten Zeiten anzustimmen. Es geht um Vielfalt, und die braucht keine monologisierende Expertise mit kurzer Halbwertszeit.
In unmittelbarer Nähe der Kultlage Kallstadter Saumagen liegt das kalkige Kleinod Felsenberg, auf dem die Brüder Andreas und Steffen Rings vor sechs Jahren französische Dijon-Klone mit extrem schwachwüchsigen Unterlagen gepflanzt haben. Schon jetzt sind die Ergebnisse aus erbsengroßen Beeren vorzüglich, was allerdings niemals gelungen wäre, wenn die beiden nicht auch im Keller äußerst sorgsam vorgehen würden, das beste Fass niemals gut genug, der letzte Eingriff womöglich immer noch einer zu viel gewesen sein könnte. Natürlich bewegen sich ihre Weine auf einem sehr hohen Niveau, denn daran wollen sie gemessen werden, sind Teil eines Höhenflugs, den der Spätburgunder derzeit erlebt, seiner Vielfalt. In Württemberg ist es der Lemberger, aus dem neben Spätburgunder vorzügliche Rotweine gekeltert werden. Wenngleich sie für weitaus weniger Aufmerksamkeit sorgen, wurden auch die Lemberger in den letzten Jahren immer besser, subtiler, feiner. »Blaufränkisch Masterclass« hieß ein Tasting, das erst kürzlich in Köln stattfand und 16 Winzer aus Deutschland und Österreich versammelte, die sich leidenschaftlich für diese Sorte einsetzen. Obschon Lemberger und Blaufränkisch verschiedene Namen für die selbe Sorte sind, hat sich letzterer in der Vergangenheit einen besseren Namen machen können.

Mittlerweile haben sich hierzulande einige Weingüter vom Lemberger ganz verabschiedet und ihn kurzerhand in Blaufränkisch umbenannt. Das funktioniert gut, weil eine beachtliche Anzahl Blaufränkischer aus der Alpenrepublik einen großartigen Ruf besitzen, der weit hinaus in die Weinwelt tönt, wo der des Lembergers schon in der eigenen Heimat verhallt ist. Das Perfide daran: In seiner Güte steht er nicht zurück. Natürlich tummeln sich auch auf dieser »Masterclass« einige der externen Experten mit ihren superschlauen Fragen, auf die sie keine Antworten erwarten. Als der junge Remstaler Winzer Moritz Haidle statt dem gewünschten Blaufränkisch nur seinen Lemberger anbieten kann, verziehen die önologischen Supernovas erst die Augenbrauen und danach sich. »Ist das nicht verrückt«, sagt Haidle, »das Renommee einer Marke verändert den Geschmack.« Auch Haidle bezieht schon seit längerem Klone aus dem Burgenland. »Wissen Sie, was mich der Rebveredler einmal gefragt hat?«, fragt er süffisant, bevor es aus ihm herausschallt: »Möchten Sie Klone aus Weinsberg oder aus Deutschkreutz?« Am Ende steht in Österreich womöglich ebenso viel Lemberger wie Blaufränkisch in Deutschland. Den Württembergern jedenfalls fällt gerade auf, dass sie im Vergleich zum Nachbarland bei wichtigen Image-Fragen ins Hintertreffen geraten sind. Aber so schlecht ist diese Erkenntnis ja vielleicht gar nicht. Veränderung gehört zur Vielfalt. Ohne sie gerät das Ökosystem außer Kontrolle, danach geht es sowie bergab.
Anzeichen dafür gibt es auch im Weinbau, der mehr oder weniger Monokultur auch mehr oder weniger krankheitsanfällig ist. ESCA heißt die heimtückischste Rebenkrankheit, mit der Winzer in den letzten Jahren immer massiver konfrontiert werden und nichts gegen das plötzliche Absterben der Pflanzen ausrichten können, da es keine direkte Behandlung gibt. Der Tessiner Winzer und Geologe Christian Zündel ist nicht der einzige Winzer, der einen Zusammenhang zwischen einer Bepflanzung mit einseitigem Klonmaterial und der tödlichen Krankheit sieht. Obschon die ESCA-Erreger auf Reben vergleichbar häufig zu finden sind, bedeutet das nicht, dass die Krankheit dort nun sicher auch zum Ausbruch kommt. Warum sie das bei der einen Pflanze tut, die nächste wiederum kerngesund bleibt, ist bis heute ungeklärt. Ist ein Weinberg allerdings mit nur einem Klon bepflanzt, erhöht sich automatisch auch das Risiko der Ausbreitung, wenn es etwa bei der Veredlung zu einer Infizierung gekommen ist, oder den Reben prädestinierende Merkmale vererbt wurden.

Die Suche nach dem Wunderklon ist ein Irrweg.Christian Zündel
© Foto Jörg Linke
»Die Suche nach dem Wunderklon ist ein Irrweg«, sagt Zündel. Ein asketischer Mann mit kurzen Haaren und bescheidenem Auftreten, der weder eine Internetseite unterhält noch E-Mails scheibt. In alpinem Ambiente zwischen Largo Maggiore und Luganer See blieb er vor den Trends der Weinwelt weitgehend verschont, oder verschonte sich vor ihnen. Wie auch immer. Heute gilt seine Arbeitsweise vielen Winzer als Vorbild, wenn sie einen Ausweg aus der Sackgasse Monokultur suchen. Eine extensive Bewirtschaftung beschreibt wohl am besten, was seit rund 30 Jahren in Zündels Heimat Beride entsteht. Seine Weinbereitung sei simpel, sagt er, »Geduld und eine sanfte Arbeitsweise.« Ob der Mann gut reden hat? Von externen Experten hat Zündel jedenfalls nichts zu befürchten, die werden schon daran scheitern, das Weingut realiter zu finden, denn Zündel lässt sich nur selten in der Öffentlichkeit blicken.