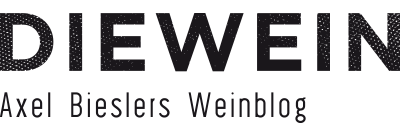VON DER ANRICHTEWEISE EINES APFELS
Wein ist ein fester Bestandteil im jüdischen Glauben, doch die Geschichte seiner Güte ist noch jung. Eine Reise durch ein Weinland voller Widersprüche
Da gibt es diese Geschichte von dem Rabbi, dessen Appetit auf ein Spanferkel so gewaltig groß gewesen sein muss, dass er seine strengen Speisegesetze einfach einmal fahren ließ und eines Tages ein Restaurant aufsuchte, nur um einmal in seinem Leben in den Genuss des ihm verbotenen Fleisches zu kommen, das man hier nur als vollständiges Tier und ganz altmodisch mit einem Apfel im Maul serviert bekam. Immerhin bestand der Rabbi auf einen Tisch in der hinteren Ecke des Lokals, wo man ihn nicht sofort entdecken würde. Als ihm nach einer angemessenen Weile das knusprige Ferkel mit dem Apfel im Maul präsentiert wurde, betrat eine Gruppe Schüler den Speiseraum und schaute sich neugierig um. Einer der Jungen entdeckte den Gläubigen und stellte ihn zur Rede: »Rabbi, warum isst du ein unreines Tier?« Seine Antwort fiel zwar nicht sonderlich überzeugend aus, war aber immerhin schlagfertig: »Mein Junge, das tue ich doch gar nicht. Ich bewundere nur die eigenartige Anrichteweise des Apfels.«
Ob die Kaschrut ihr Volk mit ihren strengen Weisungen in der Vergangenheit schon einmal vor dem Untergang bewahrte, oder ob das komplizierte Regelwerk gottgegeben ist, daran sollen sich Religionswissenschaftler und Historiker abarbeiten, das Ergebnis bleibt das gleiche: Die jüdischen Speisegesetze sind vertrackt und animieren nicht unbedingt zum Nachahmen, wenn es um spontanen Genuss und hemmungslose Schlemmerei geht. Aber dafür sind sie ja auch nicht gemacht. Der orthodoxe Jude wird womöglich darauf verweisen, dass nur Tiere, die zwei gespaltene Hufe haben und wiederkäuen, koscher sind, da das Schwein nicht wiederkäut, ist es auch nicht koscher. Mehr muss er dazu gar nicht sagen, wird er oft auch nicht. Der säkulare Jude mag von einer unendlich langen Dürre erzählen, die vor langer Zeit das gesamte Volk bedroht habe. Da trennte man sich zuerst von seinem durstigsten Vieh, den Schweinen, und strich sie bei dieser Gelegenheit vorsorglich gleich ganz vom Speiseplan.
Praxisorientiert oder spirituell begründet, die Kaschrut ist ein minutiöser Fahrplan, der vom Grundprodukt bis zum Servieren einer Speise fast keinen Arbeitsgang unkommentiert lässt. Das hebräische Wort »koscher« lässt sich mit »rein« oder »erlaubt« übersetzen, wobei letzteres besser geeignet erscheint, weil in der Kaschrut vieles ausdrücklich verboten ist. Darunter auch so delikate Genüsse, denen selbst gestandene Rabbis offenbar nicht immer widerstehen konnten. Wo andernorts bacchantische Feste Ausdruck spontaner Lebensfreude sind, führt beim gemeinsamen Essen der orthodoxen Juden die Kaschrut stramme Regie. Tatsächlich sollen die umfangreichen Speisegesetze vor allem dem eigenen Willen dienen, um später gestärkt nicht nur lukullischen Gelüsten zu widerstehen. Zuweilen mag eine solche Einstellung befremden. Wein hat mit Genuss nichts mehr zu tun, wenn er an zahlreichen Feiertagen als unverzichtbares Symbol in festgelegten Abständen und abgemessenen Mengen gereicht wird und bei fast keinem Ritual fehlen darf.

Ob die Kaschrut ihr Volk mit ihren strengen Weisungen in der Vergangenheit schon einmal vor dem Untergang bewahrte, oder ob das komplizierte Regelwerk gottgegeben ist, daran sollen sich Religionswissenschaftler und Historiker abarbeiten.
In Israel liegt der Pro-Kopf-Verbrauch derzeit bei etwa vier Litern pro Jahr, was selbst eingedenk von rund 20 Prozent Moslimen, die in dem kleinen Land leben, mehr oder weniger Abstinenz bedeutet. Dass der Wein dennoch so ein hohes Ansehen genießt, liegt offenbar fast ausschließlich an seiner religiösen Symbolkraft. Seine Güte aber fällt dabei oft zurück. So ist Wein heute auch in vielen Teilen der säkularen israelischen Gesellschaft nicht besonders angesagt. Eine seiner letzten Bastionen hält er auf Familienfesten, die sich im Laufe der Zeit kaum verändert haben und das Glas Wein zur spießigen Gewohnheit werden ließen. Selbst beim Rosch ha-Schana, dem Neujahrsfest etwa, fällt er schnell in seine Rolle als Symbolträger zurück. Mit Genuss hat das nur selten etwas zu tun.
Tel Aviv ist Israels Metropole der Gelüste, doch die Stadt ist mit etwas über 400.000 Einwohnern kleiner als man denkt, dafür aber mindestens so laut wie eine Weltstadt. Immerhin trifft der heimische Wein hier in letzter Zeit immer häufiger auf ein junges und kulinarisch engagiertes Publikum, das Essen und Trinken zu den lustvollen Dingen im Dasein eines Menschen zählt. In Tel Aviv ist auch der Wein-Genuss angekommen. Doron Rav Hon sorgt mit seinen spektakulär feinsinnigen Sphera-Weißweinen auf den Weinkarten konventioneller Spitzenrestaurants für Furore. Rami Bar-Maor hing seine Karriere als Architekt mal eben an den Nagel und gründete 2008 das Weingut Bar-Moar in Israels traditionsreichster Weinregion Shamron im Norden von Tel Aviv, wo er heute fast ausschließlich sortenreine Weine keltert, die aber mitnichten einem soufflierten Geschmacksprofil, sondern allein seiner Ästhetik gehorchen, oder eben gerade nicht und deshalb so ausdruckstark sind. Sein Cabernet Franc jedenfalls ist einmalig großartig.
In Tel Aviv ist der unbeschwerte Genuss längst angekommen
Hier trifft auch der Wein auf ein junges und kulinarisch engagiertes Publikum, das Essen und Trinken zu den lustvollen Dingen im Dasein eines Menschen zählt.
Rav Hon und Bar-Maor sind jüdische Winzer, die auf die koschere Bereitung ihrer Weine keinen Wert legen. Ihnen geht es um deren Inhalt. Und der wird mittlerweile wahrgenommen. Da es vor wenigen Jahren doch nur zwei Fragen waren: »koscher« oder »nicht koscher«, die an die Winzer gestellt wurden, muss das Interesse seitdem nicht nur größer, sondern auch differenzierter geworden sein. Israel zählt zu den neuen Weinbauländern mit einer uralten Weinbautradition, dessen Kontakt zu einer eigenen Weinkultur aber zuletzt immer schwächer wurde. Die Reduzierung israelischer Weine als Taktgeber in Ritualen ohne Bezug zu ihrem Inhalt legte sie auf eine Rolle fest, die immer weniger Spielraum zuließ. Als ihr Geschmack weiter an Bedeutung verlor, schlossen seit den neunziger Jahren immer mehr angehende Weinmacher ihr Weinbaustudium im australischen Adelaide oder kalifornischen Davis ab, bevor sie nach Hause zurückkehrten, um das neu erworbene Wissen in heimischen Gefilden auszuprobieren. Andersherum wurde aber auch Israel für eine junge Winemaker-Generation aus Australien oder Kalifornien attraktiv: Viele israelische Weingüter wollten sich an neuen Wegen im Weinberg und Keller ausprobieren und suchten händeringend nach qualifiziertem Personal. Es dauerte nicht lang, da etablierten etliche junge Önologen aus Barossa oder Nappa einen Weinstil im Gelobten Land, der dem ihrer Heimat immer ähnlicher wurde.
Ob der Wein koscher bereitet wurde oder nicht, spielt dabei überhaupt keine Rolle. Ein derart hergestellter Wein hat nämlich nichts mit einem Vin Naturelle oder etwa einem Naturwein zu tun, weil man das ja vermuten könnte, da in dem Wort »koscher« auch eine Portion rein mitschwingt. Die Anweisungen im Kaschrut für eine koschere Weinbereitung stehen denen der Speisezubereitungen in ihren peniblen Anweisungen in nichts nach, nehmen bisweilen sogar absurde Züge an: Unlängst sprach das Ministerium für Landwirtschaft eine Empfehlung aus, die Weinberge für ein Jahr brachliegen zu lassen. Doch dies nicht etwa, weil das Sabbatjahr Teil der Tora ist und für Juden wie für ihr Land eine wichtige spirituelle Rolle spielt, sondern aus ganz weltlichen Gründen: Es wurde schlicht mehr Wein produziert, als vermarktet werden konnte. Obwohl im Sinne einer nachhaltigen Landwirtschaft auch für Nicht-Juden nachvollziehbar, wurde die Einhaltung dieser Sabbatregel bei der Zertifizierung eines koscheren Weins bis zuletzt sehr flexibel gehandhabt. Gottgegeben oder praxisorientiert. Die Frage stellt sich immer wieder.

Es dauerte nicht lang, da etablierten etliche junge Önologen aus Barossa oder Nappa einen Weinstil im Gelobten Land, der dem ihrer Heimat immer ähnlicher wurde.
Eine biologische Bewirtschaftung etwa, den Verzicht auf Reinzuchthefe oder Schwefel braucht es für einen koscheren Wein jedenfalls nicht. Seine Reinheit hat heute fast ausschließlich religiöse Bedeutung. Da Trauben weder fleisch- noch milchhaltig sind, gelten sie als neutral und unterliegen wie anderes Obst oder Gemüse zunächst auch keiner speziellen Regelung in der Kaschrut. Wird aus ihnen jedoch ein Wein bereitet, kann der auch Teil einer Götzenanbetung und damit niemals koscher sein. Damit der Wein seine Reinheit behält, dürfen die Trauben ab dem Zeitpunkt ihrer Anlieferung im Weingut nur noch von den Händen eines dafür bestimmtem Rabbi auf ihrem Weg zum Wein begleitet werden, dabei kann der Rabbi freilich auch Öologe sein. Die meisten Kellermeister besitzen diesen religiösen Status allerdings nicht und müssen von nun an alle Arbeiten an den Rabbi weiter- und vor allem: abgeben. »Stellen Sie sich mal vor, man nimmt einem Maler seinen Pinsel weg, weil für die Ausführungen aus ihm unverständlichen Gründen nun ein fremder Gehilfe zuständig ist«, fragt Ze’ev Dunie so fest wie ein Seil, das sich immer enger um den Hals seines Opfers zieht, bis es erstickt, ohne etwas bemerkt zu haben. »Im Grunde ist das nichts Anderes als Entmündigung.«
In Dunies leiser Stimme scheinen Zweifel und Überzeugung fortwährend miteinander zu ringen. Ein Gehilfe, sagt er dann nach einer langen Pause, sei doch im besten Fall nur in der Lage, den Anweisungen seines Meisters einigermaßen Folge zu leisten. Der letzte Kniff, eine spontane Idee, eine Eingebung gar gehen dabei aber zwangsläufig verloren. Das sei bei der Schöpfung eines Bildes genauso wie bei der eines Weins. Die Kunst sei dahin. Dunie gehört wie Rav Hon oder Bar-Moar zu einer Winzer-Avantgarde, die gerade dabei ist, dem israelischen Wein ein eigenes, unverwechselbares Gesicht zu verleihen. Sein kleines Boutique-Weingut »Seahorse« liegt in den Bergen von Jerusalem, wo die Reben auf bis zu 700 Metern wachsen und einem extremen Klima ausgesetzt sind. Und so schmecken auch seine Weine: eigen, kompromisslos, nie schablonisiert. Er benennt sie nach Künstlern, die wichtig in seinem Leben sind, nach Lehrern, die ihm etwas Wichtiges für sein Leben gelehrt haben.
»Was auch immer Du tust in Deinem Leben«, zitiert Dunie einen seiner Professoren gerne und oft, »Du musst Spaß daran haben.« Wer mag es ihm da verdenken, dass er keinen Spaß versteht, wenn es um die äußerst frugale Art seiner Weinbereitung geht, die er nicht aus seinen Händen geben will? Mögen sich seine Eingriffe im Keller auch auf das Allernötigste beschränken, bedeutet das nicht, dass seine Anwesenheit überflüssig ist. Im Gegenteil: Dunie will hautnah dabei sein, wenn seine Moste zu Weinen werden, deren Persönlichkeit am Ende auch aus seinen Gedanken und Emotionen bestehen. Dass sein Wein weniger koscher sei, weil Dunie die strengen Regeln des orthodoxen Judentums nicht einhält, bezweifelt er nicht nur, sondern sagt: »Natürlich ist mein Wein koscher.« Augenzwinkernd reibt er Daumen an Mittelfinger und meint damit vermutlich: Die Konsultierung eines Rabbinats bis zur Zertifizierung eines Weins als »koscher« ist eine kostspielige Angelegenheit.

Uri Buri und Ze’ev Dunie. Der eine gilt als bester Fischkoch des Landes, der andere als Avantgardist in Weinberg und Keller. Beide teilen eine tiefe Verbundenheit zu ihrer Heimat, der Kaschrut indes wollen sie nicht immer folgen.
Je strenger die Kaschrut-Regeln eingehalten werden, desto teurer gerät auch das Zertifikat. Es gibt viele Zertifikate. Zuweilen sind die Rückenetiketten mit ihnen zugepflastert, von ultraorthodoxen Juden en détail zu einem Wein begleitet, der auch strengsten Ritualen gerecht, verkehrsfähig für die bestimmte Auslegung einer Religion gemacht wird.Tatsächlich gilt das strenggenormte System für die Bereitung koscherer Weine als Vorläufer der Qualitätsmanagementnorm ISO 9001. Gottgegeben bleibt am Ende doch ein weites Feld. Rami Na’aman bestellt es mit seiner Frau Bettina im Süden Galileas seit 2001 ausschließlich mit roten Rebsorten wie Cabernert Sauvignon, Cabernet Franc, Syrah oder Petit Verdot und benennt seine Weine nach legendären Rockgruppen. Natürlich muss sein Rosé da »Pink Floyd« und seine tiefdunkle Cuvée »Deep Purple« heißen. Wie die meisten der israelischen Winzer-Avantgarde ist auch Na’aman Quereinsteiger, war wie Dunie in seinem vorherigen Leben Filmemacher, wenn auch in einem ganz anderen Genre. Dennoch scheinen sich der bedächtig-zweifelnde Dunie und der freimütig-gemütliche Na’aman in einer Sache einig zu sein: Gegen einen koscheren Wein haben sie nichts, das Prozedere seiner Herstellung ist ihre Sache aber nicht. Na’aman gehört übrigens zu den Gründern einer Bewegung mit dem Namen »Wine Netto«, die eine für den Konsumenten transparente Weinerzeugung ohne vermeintlich überflüssige Behandlungsmittel im Weinberg und Keller propagiert. Das ist prinzipiell so koscher wie der Serviervorschlag des Rabbis am Anfang der Geschichte, nur ohne ISO-Norm – und irgendwie auch ziemlich spirituell.