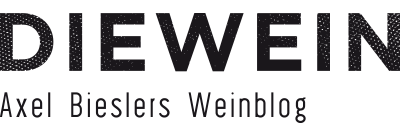FLATTERNDE TONREIHEN
Wir sind des Weines wegen in den Libanon gereist. Es sollte lange dauern, bis wir den ersten Schluck von ihm kosten durften. Eine Annäherung.
Der Morgen bricht an. Aus dem Küsten-Highway ist eine holprige Straße geworden, die sich ihren staubigen Weg über die Berge in ein armseliges Dorf asphaltiert hat. Hier stranden wir. Die maroden Gebäude sind mit einem abenteuerlichen Materialmix zusammengeflickt, deren Fassaden ein bunter Flickenteppich aus Kleidungsstücken überzieht. Als hätten sie sich für ein Fest geschmückt. Warme Böen ziehen sanft durch das Dorf, prallen geräuschlos an den Fassaden ab und bringen die Wäschestücke in sanfte Bewegungen. Flatternde Tonreihen mischen sich unter die morgendliche Stille. Seit Stunden irren wir umher. Das Hotel sei nicht weit vom Beiruter Flughafen entfernt, eine halbe Stunde vielleicht, hat man uns gesagt. Einheimische haben gut reden, wenn man in die Ferne schweift, dachten wir, und fuhren unbeirrt weiter. Das Navigationsgerät führte uns schnurstracks immer tiefer in dieses karstige Nirgendwo.
Der Gesichtsausdruck seines Kameraden signalisiert Hilfsbereitschaft und Autorität in wohlkontrolliertem Proporz
An der Auffahrt zu einer freistehenden Appartement-Anlage schieben zwei Soldaten vor einer Baracke Wache. Der eine ist von untersetzter, durchtrainierter Statur. Er hat kurze blonde Haare und ein ovales Gesicht mit einer platten Nase, wie man sie bei Profiboxern häufig sieht. Der Gesichtsausdruck seines Kameraden signalisiert Hilfsbereitschaft und Autorität in wohlkontrolliertem Proporz. Er muss jünger sein, wenig älter als zwanzig Jahre. Der militärische Drill scheint seine natürliche Neugierde noch nicht gebrochen zu haben. Vielleicht sollte er das auch gar nicht. Die meisten Libanesen haben eine gute Meinung vom Militär. Sein martialisches Gesicht hat es längst verloren, ist Alltag geworden. Ohne seine hierarchische Befehlsstruktur wäre der labile Staat schon lange zusammengebrochen. Davon sind viele Libanesen überzeugt. Das Militär beschütze sie, sagen sie.
»Ihr solltet nicht hier sein«, sagt der junge Soldat
Die reguläre Polizei ist schlecht ausgerüstet und wird öfter belächelt als ernstgenommen. Sie seien »Special Forces«, sagen die Soldaten. Als wir ihnen unsere missliche Lage verständlich gemacht haben, lachen sie uns aus. Fast bis zur »Blauen Linie«, an die Grenze zu Israel haben wir es geschafft. Das Gebiet wird von Milizen der Hisbollah kontrolliert. Die Luft ist trocken und warm an diesem ersten August. »Ihr solltet nicht hier sein«, sagt der junge Soldat. »Von Bhamdoun seid ihr sehr weit entfernt«. Sie stecken ihre Köpfe zusammen und besprechen sich. Der ältere von den beiden führt zwei Telefonate, von denen keines länger als 20 Sekunden dauert. Die Hisbollah hat keinen schlechten Ruf im Libanon, ihre Miliz sehe dem Militär zum Verwechseln ähnlich, hört man oft, und dass die sich den meisten Fremden gegenüber sehr hilfsbereit zeige. Der Untersetzte kommt zu uns und sagt: »Unsere Ablöse ist bald da, dann lotsen wir euch auf den richtigen Weg.« Der junge Soldat übernimmt das Steuer unseres Mietwagens, während der andere in einem Pickup vorausfährt.

Auf dem staubigen Parkplatz einer verlassenen Polizeistation liegen Dutzende bröckelnder und zerschossener Betonbarrieren umher. Ein verbeulter schwarzer Chevrolet mit den Notrufnummern »999« und »112« auf seinen Türen hat seinen Dienst offenbar schon vor einiger Zeit quittiert.
An einem Kiosk hält er kurz an und reicht uns zwei kleine Plastikbecher mit heißem Mokka und Wasserflaschen durchs Fenster. Wir fahren die holprige Straße zügig zurück, bis sie wieder zu jenem Küsten-Highway nach Beirut geworden ist, den wir heute schon einmal in entgegengesetzter Richtung befahren haben. In Schnappschüssen taucht das Meer auf, wird im nächsten Moment wieder von Betonbauten verhüllt. In manchen erkennt man Geschäfte und Werkstätten, andere sind halbverfallen oder als Rohbau zurückgelassen. Kurz vor Beirut durchfahren wir einen Tunnel, in dem sich ein unerträglicher Gestank eingenistet hat. Als er schon lange verflogen ist, riechen wir ihn immer noch. »Doch, doch der Libanon besitzt Kläranlagen«, erzählt der junge Soldat am Steuer, »nur funktionieren die meisten nicht.« Das Abwasser werde dann einfach ungeklärt direkt in Flüsse oder ins Meer gepumpt. Und das stinke eben gewaltig.
Am Ende lag Beirut in Schutt und Asche
Wo Beirut aufhört und seine Vororte beginnen, ist kaum auszumachen. Im Bürgerkrieg verlief die Frontlinie mitten durch die Stadt. Am Ende lag Beirut in Schutt und Asche. Beim Wiederaufbau spielte seine 6000-jährige Geschichte keine Rolle mehr. Hochhäuser statt Denkmäler. Korruption wucherte im gleichen Maße, wie sich Libanons Hauptstadt zu einem bösartigen Geschwür auswuchs. Schätzungen gehen davon aus, dass heute über zwei Millionen Menschen in Beirut leben, rund ein Drittel der gesamten Bevölkerung. Genaue Zahlen gibt es nicht. Es ist jenes Ungleichgewicht, das dem Land zu schaffen macht. Die jungen Libanesen zieht es so schnell wie möglich vom Land in die Stadt.
Alle verkaufen den exakt gleichen Nippes
Der Menschenstrom aus dem benachbarten Syrien spülte mehr als eine Million Menschen über die Grenzen. Die meisten Flüchtlinge landen in Zeltlagern an den ausgefranzten Rändern Beiruts. Sobald der Verkehr auf dem Coastal Highway zum Erliegen kommt, ziehen in schwarze Burkas gehüllte Frauen bei brütender Hitze bettelnd an den Fahrzeugen vorbei. Kinder strecken den Menschen in den Autos Schachspiele, Plüschpuppen und Fächer entgegen. Alle verkaufen den exakt gleichen Nippes. Die Bettler sind organisiert. An einer Abzweigung hält der vorausfahrende Pickup. »Nach Bhamdoun sind es nur noch wenige Kilometer«, sagen die Soldaten zum Abschied.
Die motorisierten Zweirad-Baristas fahren sorglos in der Gegend umher und scheren sich nicht um die Gesetze der Physik. Ein abenteuerliches Ungleichgewicht wird einfach neu ausgewuchtet.

Flankiert von prachtvollen Villen, mit weitem Blick über die Stadt und das Meer, schrauben wir uns weiter die Straße hinauf. Die Aussicht wird immer besser, »Bell-Vue« ist nicht in Sicht.

Das Hotel finden wir noch lange nicht. Es heißt »Le Telegraphe de Bell-Vue«. Keiner der Menschen, die wir nach ihm fragen, kennt es. Ohne es zu bemerken, fahren wir etliche Male durch Bhamdoun. Eine einheitliche Beschilderung gibt es nicht. Der libanesische Staatsapparat ist ein vertracktes Gebilde – und die meiste Zeit handlungsunfähig. Mäzen aus der Diaspora sorgen auf eigene Kosten und mit unterschiedlichen Präferenzen für Ordnung. Auf dem staubigen Parkplatz einer verlassenen Polizeistation liegen Dutzende bröckelnder und zerschossener Betonbarrieren umher. Ein verbeulter schwarzer Chevrolet mit den Notrufnummern »999« und »112« auf seinen Türen hat seinen Dienst offenbar schon vor einiger Zeit quittiert. »Hotel« buchstabiert ein erloschenes Neonschild in grünen Lettern aus zerbrochenem Plastik.
Ausrangierte Wohnmobile campen dauerhaft als Mini-Markt und Kaffeebude an den Straßenrändern
Die letzten Gäste sind lange abgereist. Überall öffnen jetzt Kaffee- und Snack-Buden ihre Geschäfte. Auf den schmalen Gepäckträgern alter Mopeds sind beachtliche Halterungen mit allerlei Kaffeeutensilien montiert. Für Tabakwaren und kleine Snacks fand sich auch noch ein selbst gezimmerter Platz. Die motorisierten Zweirad-Baristas fahren sorglos in der Gegend umher und scheren sich nicht um die Gesetze der Physik. Ein abenteuerliches Ungleichgewicht wird einfach neu ausgewuchtet. Ausrangierte Wohnmobile campen dauerhaft als Mini-Markt und Kaffeebude an den Straßenrändern. Neben dem traditionellen Mokka haben sie diverse Instant- und Coffee to go-Produkte im Angebot. Die junge Generation macht sich nicht mehr so viel aus einem Ritual, bei dem der Mokka mit Kardamom und Muskat gewürzt, mindestens dreimal aufgekocht und in feinem Porzellan serviert wird. Dem Zeitgeist der Turbo-Verschwendung aus Plastikbechern und -flaschen hat das Land wenig entgegen zu setzen. Er ist allgegenwärtig. Libanons Müllentsorgung ist in privaten Händen und wird vom Staat nur lax kontrolliert. Je mehr wohlhabende Einwohner ein Ort hat, desto weniger vermüllt ist er. Ohne dem Geld und dem Engagement aus der Diaspora wäre es um den Libanon heute vermutlich noch schlechter bestellt.
Da machte man die Hotellerie im Libanon womöglich zur Nachkriegsfamiliensache
Flankiert von prachtvollen Villen, mit weitem Blick über die Stadt und das Meer, schrauben wir uns weiter die Straße hinauf. Die Aussicht wird immer besser, »Bell-Vue« ist nicht in Sicht. Auf einem Schild lesen wir »Château« und »Hotel« und phantasieren uns endlich am Ziel. Als mächtiger schmiedeeiserner Bogen schlägt sich der Name »Bernina« in Frakturschrift über eine verbuschte Einfahrt. Ein 4000er in den Ostalpen im Kanton Graubünden heißt so, eine Schmalspurbahn mit gleichem Namen tingelt zwischen St. Moritz und Tirano hin und her. Unter dem Bogen steht in arabischer und römischer Schrift: »German Management«. Festivitäten mit bis zu 1000 Gästen könne das Hotel der »Baronne von Necker« ausrichten, gibt eine kleine Tafel neben dem Eingangstor Auskunft. Ein gewisser Horst von Necker brachte es im Zweiten Weltkrieg bis zum Generalmajor der Deutschen Luftwaffe und sammelte während dieser Zeit etliche hohe militärische Auszeichnungen. Da machte man die Hotellerie im Libanon womöglich zur Nachkriegsfamiliensache.
Die Zeit muss diesen Ort vergessen haben
In der Lobby erzeugen unsere Schritte ein weiches Knarren auf dem Parkett. Als wir stehen bleiben und uns umschauen, schieben die alten Holzbohlen das heller werdende Geräusch noch einen kurzen Moment weiter durch den düsteren Raum. Unzählige Schwarz-Weiß-Fotos erzählen von prachtvollen Empfängen, die das Hotel einst erlebt haben muss. Die meisten Bilder stammen aus den sechziger, nur wenige aus den siebziger Jahren. Dann kam der Krieg. Die Zeit muss diesen Ort vergessen haben. Über dem Empfangsbereich hängt ein übergroßes Portrait der Baronin. Ihr Blick ist streng, das Haar glatt nach hinten gekämmt. In der hinteren Ecke des Raumes schlägt ein geruhsam schwingendes Pendel die sanften Töne einer Standuhr an. Der Rezeptionist muss mit den von Neckers in den Libanon gekommen sein. Er ist geblieben und hinter seinem Tresen alt geworden. Sein faltiges Gesicht ist groß und fleischig. Wo wir herkommen, will er wissen und zählt mit heiterem Blick ungefragt all die deutschen Städte auf, in denen er vor langer Zeit einmal gelebt hat. Von einem Hotel »Bell-Vue« wisse er nichts, aber Bhamdoun kenne er wohl. Der Weg dorthin führt uns wieder zurück. Das Ortsschild ist weder besonders groß, noch an einer sichtbaren Stelle angebracht. Wer es noch nie gesehen hat, wird es ignorieren.